von Felix Menzel vom 9. Oktober 2019.

Über Die Kunst, Recht zu behalten, notierte Arthur Schopenhauer vor fast 200 Jahren: „Wenn man merkt, daß der Gegner überlegen ist und man Unrecht behalten wird, so werde man persönlich, beleidigend, grob.“
Schopenhauer ahnte, daß gegen diese Strategie kein Kraut gewachsen ist. Begebe man sich auf das Niveau des Gegenübers, arte die Diskussion zu einer Prügelei aus. Kontere man dagegen „ganz gelassen“ mit Sachargumenten, provoziere man die „Erbitterung des Besiegten“ und damit immer neue Boshaftigkeiten.
Als Ausweg aus dieser Misere empfahl Schopenhauer, nur mit denen zu disputieren, die wirklich an der Wahrheitsfindung Interesse zeigen. Doch das bedeutet, daß „unter Hundert kaum Einer“ als geeigneter Gesprächspartner zu finden sei. Sofern sich ein Philosoph wirklich nur der Wahrheitssuche verpflichtet sieht, dürfte er mit dieser zwangsläufigen Außenseiterrolle gut leben können.
Bei einem Politiker sieht das anders aus. Er muß in einem intensiven Konkurrenzkampf Anhänger begeistern, Wahlen gewinnen und Mehrheiten organisieren. Recht zu haben, reicht hier bei weitem nicht aus. Weil Politik in jeder Situation an eine „konkrete Gegensätzlichkeit“ gebunden sei, setze sich eine polemische Rhetorik durch, war sich Carl Schmitt sicher.
Nur wer dies berücksichtigt, wird die alltäglichen Anfeindungen im politischen Geschäft richtig einordnen können. Jede Partei setzt in einem gewissen Maß auf „Haß und Hetze“. Jede Partei spielt mit Ängsten, wenn es ihr einen Vorteil bringt. Und jede Partei nutzt die persönlichen Schwächen der Konkurrenz eiskalt aus. In einer Massendemokratie gilt das als wirksam und nur das zählt anscheinend.
Die Rede von einem „neuen Zeitalter des Populismus“ in diesem Zusammenhang ist trotzdem irreführend. Sie suggeriert, wir lebten in einer ungewöhnlichen Epoche. Aber das Gegenteil stimmt: Entfällt die polemische Aufladung der politischen Begriffe, werden sie laut Schmitt zu „leeren und gespenstischen Abstraktionen“. Die Konsequenz ist dann ihre inhaltliche Entkernung.
Genau das erlebten wir in der bundesrepublikanischen Biedermeierzeit vor Ausbruch der Euro- und Asylkrise. Sie war geprägt von einer schleichenden Erosion der Demokratie und des Rechtsstaates, weil die etablierte Öffentlichkeit nur noch in Floskeln über das Grundsätzliche sprach und die im Bundestag vertretenen Parteien keine wahrnehmbaren Unterschiede mehr boten.
Insofern ist die Polarisierung der Gesellschaft geradezu notwendig. Müssen Eliten mit dem erbitterten Widerstand des Volkes oder „populistischer“ Parteien rechnen, werden sie sich zweimal überlegen, was sie hinter verschlossenen Türen beschließen. Doch kann man diesen Protest nur mit Begriffen wie „Volksverräter“, „Lügenpresse“, „linksgrün versifftes Establishment“, „Raute des Schreckens“ und Verunglimpfungen wie „Scharia Partei Deutschland“ artikulieren?
Europas populärster und wohl auch erfolgreichster Populist Matteo Salvini, dem auf Facebook 3,8 Millionen Fans folgen und auf Twitter ebenfalls stolze 1,15 Millionen, hat ganz sicher diese Tonlage drauf, wie die linksliberale Presse zur Genüge dokumentieren konnte. Das beherrschen allerdings viele. Er muß also noch weitere Qualitäten mitbringen.
Welche dies sind, hat die Journalistin Chiara Giannini hervorragend aus ihm herausgekitzelt. Ihre einhundert einfühlsamen Fragen hätte Salvini als Steilvorlage für Selbstbeweihräucherung und eine knallharte Abrechnung mit der politischen Konkurrenz nutzen können. Auf den ersten Blick wäre dies in seinem Interesse gewesen und Politiker agieren nun einmal hauptsächlich interessengeleitet.
Zum Glück widerstand er jedoch dieser Versuchung. Mehr noch: An keiner einzigen Stelle in dem gesamten Gespräch findet sich eine despektierliche Äußerung. Angesprochen auf die „extremere Linke“ würden sicherlich viele AfD-Politiker auf die brutalen Anschläge der militanten Antifa hinweisen. Salvini indes gibt den Genossen den ungefragten Rat, sie sollten endlich „zu ihren Themen zurückkehren (…), die sie in den letzten Jahren vernachlässigt haben: die Arbeit, die Belange der Vorstädte, die Renten“.
Zu den NGOs im Mittelmeer, die als Schleppertaxis fungieren, sagt er, es liege ihm fern, sie zu schmähen, aber er sei beunruhigt, da sie als „Pull-Faktor“ für mehr Tote auf See sorgen. Verständnis zeigt er auch für jene Richter, die ihm als Innenminister zusetzten. Sie hätten die schwierigste Arbeit der Welt, lobt er sie überschwenglich, um später dennoch Kritik zu üben.
Noch besser ist die Antwort auf die Frage „Was denken Sie über Soros?“. Sie hat es verdient, in jedes Rhetorik-Lehrbuch aufgenommen zu werden, denn Salvini unterstreicht nur das Positive: „An Soros schätze ich seine Transparenz.“ Auf der Internetseite der Open Society Foundations könne man schließlich „schwarz auf weiß nachlesen“, daß ein „nicht wiederzuerkennender Westen, der völlig entstellt und durchmischt ist von der Aufnahme riesiger Migrantenströme aus Afrika und anderswo, als eine große Errungenschaft der Zukunft präsentiert“ werde.
Was Salvini hier gelingt, ist äußerst selten: Während die meisten Politiker Schaum vor dem Mund haben und sich von ihrem Freund-Feind-Denken zu knöchernen Attacken verleiten lassen, die häufig unter die Gürtellinie gehen, bleibt er souverän und behält damit eine positive Aura.
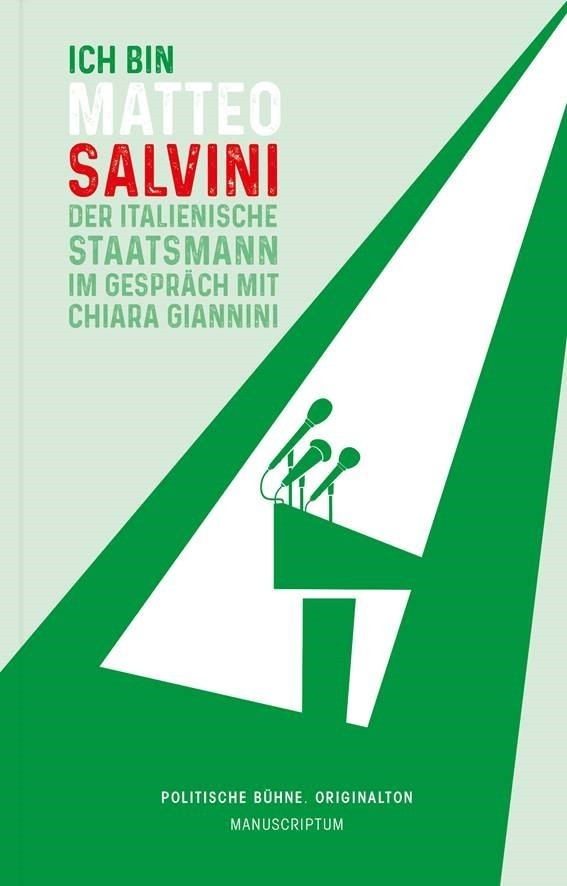
Chiara Giannini/Matteo Salvini: Ich bin Matteo Salvini. Der italienische Staatsmann im Gespräch.
Die politmediale Öffentlichkeit in Deutschland ist ein artenarmes und steiniges Gelände: Brennessel und Brombeere wuchern, aber sobald sich trotz der der intellektuellen Nährstoffarmut ein anderes Pflänzchen zeigt, soll’s im Namen der Vielfalt mit Herbizid behandelt werden.
