im Gespräch mit Dr. Philipp Bender.

Die Europäische Union sieht der Jurist Philipp Bender als „Antriebswelle“ einer globalistischen Weltwirtschaftsordnung. Die EU-Eliten würden deshalb auch nicht davor zurückschrecken, die von ihnen selbst geschaffenen Paragraphen zu ignorieren, um so auf Biegen und Brechen das wacklige Konstrukt der gemeinsamen Währung zu retten. Wo führt das hin? Und vor allem: Welche Alternative gibt es für Europa? Im Gespräch mit Manuscriptum skizziert Philipp Bender, einer der Autoren von „Europa Aeterna“, eine hesperialistische Wende, die sich das Ziel setzen sollte, eine „Verfassung für die Ewigkeit“ zu schaffen.
Manuscriptum: Sehr geehrter Herr Dr. Bender, Anfang des neuen Jahrtausends sind die ersten Versuche, Europa eine Verfassung zu geben, krachend gescheitert. In mehreren Staaten fiel diese Idee bei den Bürgern in Volksentscheiden durch. Warum wünschen Sie sich dennoch eine neue Verfassung für Europa?
Dr. Philipp Bender: Im Frühsommer 2005 scheiterte dieser „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ als technokratisches Eliten-Projekt von EU-Europa. Schon der sperrige Name weist auf seinen gouvernementalen und völkerfernen Charakter hin. Die geistige Grundlegung für neuartige Verfassungsinitiativen besteht darin, ebendiese EU nicht mit Europa zu verwechseln, wie das landläufig propagandagesättigte Zeitgenossen leider zu tun pflegen.
„Europa“ nenne ich die Einheit eines in langer gemeinsamer Geschichte gereiften kulturellen Bewusstseins, wobei sodann ein Weg über das (Selbst-)Bewusstsein zum Willen führt. Meine Europakonzeption ist also keine exklusiv-geographische, sondern eine kulturelle wie aber auch voluntaristische. Nicht jeder Erdenbürger, der sich selbst gerne als „Europäer“ sähe und womöglich noch dem Appell zu irgendwelchen abstrakten und nur angeblich universalistischen Werten wie Freiheit, Demokratie, Gleichheit oder Menschenrechten Folge leistet, wird jedoch dadurch zum europäischen Menschen.
Wenn es also den Willen zu einem europäischen Gemeinwesen gibt, dann sollten in einer rechtsverbindlichen Verfassung die Grundaussagen und Grundlagen festgeschrieben werden, also insbesondere zum Institutionengefüge oder zu Rechtsetzungs- bzw. Verwaltungskompetenzen in einer neu zu schaffenden Konföderation. Diese basale Ordnungsfunktion einer Verfassung ist unerlässlich. Gleichzeitig muss sich mit dem Verfassungsdokument darüber verständigt werden, aus welchem Selbstverständnis heraus, zu welchem Zweck und mit welchen Zielen überhaupt der trans- oder supranationale Zusammenschluss gesucht wird. Ohne den Text zu überfrachten und kulturell-kitschig, also „überkandidelt“ zu werden, sollte ergründet werden, worin ein überstaatlicher, europäischer Gemeinsinn besteht. Grundsätzlich sollte es Anspruch sein, eine Verfassung für die Ewigkeit zu schreiben – auch wenn uns natürlich die Geschichte lehrt, dass kein Verfassungskonstrukt ewig Bestand hat.
In diesem Sinne sind die EU-Verträge, die übrigens die wesentlichen Inhalte der 2005er-Verfassung mit dem Vertrag von Lissabon aufgenommen haben und gerne als „europäisches Verfassungsrecht“ bezeichnet werden, keine Verfassung, sondern eher ein permanenter Integrations- und Fortschreitungsauftrag. Das „Immer enger“ (ever closer union, Art. 1 des EU-Vertrags) kennt nur Dynamik, keine Finalität und erst recht keinen „Endzweck“. Die Integration, was nichts anderes als ein unersättliches Kompetenzraffen auf EU-Ebene meint, wird zum ausschließlichen Selbstzweck der Union. Dezentralität und Subsidiarität bleiben fromme, aber letztendlich naive Wünsche.
Ein Gründungsdokument für eine neuartige europäische Konföderation, für das David Engels mit seiner Präambel den Aufschlag gemacht hat, sollte Integrationszweck und -grenze final und imperativ beschreiben. Zuständigkeiten sollten zwischen Konföderation und Mitgliedstaaten abschließend zugeordnet sein und der Grundsatz der Subsidiarität muss oberstes, ja „heiliges“ Strukturprinzip werden.
Bis Mai lief die sogenannte „Konferenz zur Zukunft Europas“. Laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gab dieses Forum jungen Europäern die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit der EU-Führung eigene Visionen voranzubringen. Was halten Sie von diesem Projekt? Sollte in ähnlicher Weise eine Verfassung erarbeitet werden?
Diese „Zukunftskonferenz“ richtete sich nicht ausschließlich an junge Europäer, aber Sie haben völlig Recht, dass immer behauptet wurde, es würde hier vor allem die Stimme der europäischen Jugend erhört werden. Offenbar sollte das besonders „innovativ“ oder „progressiv“ wirken.
Die Idee, der „Stimme der Europäer“ im EU-Staatenverbund mehr Gehör zu verschaffen, stammte ursprünglich von Präsident Macron, wurde aber bereitwillig – und wohl im Gegenzug für ihre Wahl – von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Sommer 2019 aufgegriffen. Über eine digitale Plattform, nationale wie europäische Bürger-Panels und schließlich eine Art „parlamentarische Versammlung“ (Plenary) sollten Europäer Reformvorschläge einbringen können und diese debattieren. Vorangetrieben wurde das Ganze vor allem durch die Kommission und das Europäische Parlament, die sowohl über den gemeinsamen Vorsitz als auch über ein sogenanntes „Executive Board“ den entscheidenden Einfluss auf den Konferenzverlauf nahmen.
Insgesamt betrachtet blieb das Interesse der EU-Bürger aber eher überschaubar. So haben auf besagter digitalen Plattform nur etwas mehr als 50.000 Menschen mit Ideen und Diskussionsbeiträgen mitgewirkt, was 0,017 % der erwachsenen Gesamtbevölkerung aller EU-Länder entspricht. Mitglieder von einzelnen Panels wurden von einer privaten Agentur per Zufallsprinzip entlang soziologischer Kriterien wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildungsstand etc. ausgewählt, eingeladen und auch inhaltlich betreut. Im Plenary saßen dagegen weit überwiegend Berufspolitiker der EU- wie auch der mitgliedstaatlichen Ebene, also ohnehin abhängigkeitsbedingte Pro-Europäer.
Das Projekt der Zukunftskonferenz verwechselte dabei in stupender Beschränktheit Repräsentativität mit demokratischer Legitimation. Nicht ein einziges Organ oder ein einzelner Teilnehmer dieser Konferenz wurde – in dieser konkreten Funktion – von den EU-Bürgern demokratisch gewählt. Das ganze Spektakel fußte auf einem angemaßten, weil außerrechtlichen „interinstitutionellen Mandat“ von Kommission, Parlament und Rat, was einem Putsch von oben gleichkommt. Zwar sind die Ergebnisse der Konferenz nicht rechtsverbindlich und sie ersetzt (offiziell) auch nicht die für Vertragsänderungen bzw. Rechtsetzung zuständigen EU-Institutionen. Doch Kommission, Parlament und auch Rat haben sich in einer gemeinsamen Stellungnahme dazu verpflichtet, sich an die Vorschläge der Zukunftskonferenz zu halten und diese umzusetzen. Der Output-Gedanke bleibt zentral.
Es ging im Kern darum, an den Mitgliedstaaten – den eigentlichen „Herren“ der EU – vorbei eine Art partizipatorische „Bottom-up-Demokratie“ anzuerkennen, die den EU-Verträgen jedoch völlig fremd ist. Die (ohnehin defizitäre) demokratische Legitimation der Union wird wesentlich über die in ihr zusammengeschlossenen Nationalstaaten vermittelt. Wie gesagt, hielten insbesondere Kommission und EU-Parlament sämtliche organisatorischen Zügel in der Hand und machten auch ganz konkret inhaltlich-programmatische Vorgaben.
Besonders übergriffig war die sogenannte „Konferenzcharta“ ausgestaltet, der jeder Teilnehmer im Vorhinein zwingend zustimmen musste. Hier wurde jeder dazu angehalten, „unsere europäischen Werte“ aus Artikel 2 des EU-Vertrags zu achten, also „Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Personen, die Minderheiten angehören“. So weit, so gut. Doch es schloss sich die vielsagende Aussage an, dass diese Werte „ausmachen“ – im Sinne von „bestimmen“ – was es bedeutet, „Europäer/in zu sein“. Die Wertehypertrophie der EU maßt sich mittlerweile unverblümt an, festzulegen, wer Europäer ist und wer nicht. Nur wer sich diesen Werten und ihrer immer haltloseren Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) bedingungslos unterwirft, gilt dem EU-Regime noch als Europäer.
Das ganze Schauspiel hatte eher etwas von einem technokratischen Cäsarismus, in dem von oben vorgegebene ideologische Zielsetzungen lediglich alibi-direktdemokratisch abgenickt wurden. Die Debatten waren von der EU-Führungsriege zu keinem Zeitpunkt als tatsächlich ergebnisoffen oder frei konzipiert, sondern hatten sich in engen programmatischen und weltanschaulichen Bahnen zu halten. Wir werden sehen, wie die Institutionen der Union in Zukunft mit den Ergebnissen dieser Konferenz umzugehen gedenken. Zusammenfassend betrachtet, taugt dieser nicht legale, pseudo-demokratische und zentral gelenkte Popanz nicht als Blaupause für eine zukünftige Verfassungsinitiative.
Warum waren bisher weder die EU noch ihre Vorläufer seit den 1950er-Jahren in der Lage, sich eine eigene Verfassung zu geben? Sehen Sie darin einen Geburtsfehler oder wäre nicht zumindest nach der Deutschen Einheit ein solcher Schritt naheliegender gewesen, als eine gemeinsame Währung aufzubauen?
Glaubt man Historikern und eingeweihten Zeitzeugen, war ja gerade die deutsche Zusage zu einer gesamteuropäischen Währungsunion die Bedingung unserer Nachbarn, um der deutschen Wiedervereinigung zuzustimmen.
Dennoch bleibt Ihre Frage berechtigt: Seit den Anfängen der „Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ (Montanunion) in den 1950er Jahren blieb das Projekt der transnationalen Integration auf dem europäischen Kontinent konzentriert auf wirtschaftliche Fragen, insbesondere solche des gemeinsamen Binnenmarktes. Es ging den beteiligten Staaten darum, gegenseitige Kontrolle und Regulierung der bedeutsamsten Industrien zu ermöglichen; damals zwecks Friedenssicherung und heute im Namen des alles dominierenden Endkampfes gegen den Klimawandel. Sämtliche Verträge von der Montanunion über die Europäische(n) Gemeinschaft(en) bis hin zur heutigen Wirtschafts- und Währungsunion regeln Fragen des gemeinsamen Binnenmarktes und hierauf bezogener Grundfreiheiten, der Zollunion, des Wettbewerbs zwischen Unternehmen und Fragen staatlicher Beihilfen. Der einzelne EU-Bürger ist im Lichte dieses sogenannten „Primärrechts“ vor allem Wirtschaftsteilnehmer, etwa als Arbeitnehmer, Dienstleistungserbringer oder -empfänger, Unternehmer oder Kapitalinvestor.
Mit gutem Recht wird der EU eine allzu ökonomiezentrierte, ja neoliberale Schlagseite attestiert. An einer tatsächlichen Verfassung, die den Namen verdient, können Neoliberalismus und Globalismus auch kein Interesse haben. Wäre der Europäer nicht nur losgelöster Marktakteur, sondern wahrer „Verfassungsbürger“, so hieße das ja zum Beispiel, dass er sich gegenüber der staatlichen oder auch überstaatlichen Hoheitsgewalt auf verfassungsrechtlich verbürgte Grundrechte berufen könnte oder ihm spiegelbildlich Grundpflichten auferlegt wären.
Nach verbreiteter Dogmatik folgen aus den Grundrechten auch Schutz- und Leistungspflichten, die den nationalen wie supranationalen Grundrechtsadressaten dazu anhalten müssten, die übelsten Verwerfungen eines globalen Turbokapitalismus von seinen Bürgern und Völkern fern zu halten oder zumindest abzumildern. Man denke etwa an eine effektive Finanzmarktregulierung, Arbeitnehmerschutz, Zölle und Protektionismus, Regeln zum Umwelt- und Artenschutz oder auch allgemein an das Mammutprojekt der De-Globalisierung – das fürchten die Marktenthusiasten natürlich seit jeher wie der Teufel das Weihwasser!
Sieht sich die derart imprägnierte EU also lediglich als Puzzlestück – oder gar als Antriebswelle – einer maximal „freien“, das heißt deregulierten Weltwirtschaftsordnung, dann wird sie sich natürlich davor hüten, sich mit (im besten Sinne) konstitutionellen Rechtsregeln zu binden. Der globale Neoliberalismus liebt ausschließlich das Offene, Flexible, Vorläufige, Veränderbare, Dynamische und Quantifizierbare. Alles qualitativ Verfasste und Abgeschlossene ist ihm immanent fremd – es sei denn, festgeschrieben werden lediglich seine Zugriffs- und Verfügbarkeitsprivilegien.
Wir sehen, dass selbst das EU-Primärrecht als liberalistische Marktordnung noch über den Haufen geworfen werden muss, wenn es etwa darum geht „den Euro zu retten“ und die Transfer- und Schuldenunion weiter zu vertiefen. Der kurzatmigen EU-Politik sind de facto keinerlei rechtliche Bindungen auferlegt und der EuGH wird auch die frechste Vertragsverletzung noch als rechtskonform durchgehen lassen.
Damit die Verfassung keine leere Hülle werde, müsse es zunächst eine europäische „Identitätsgemeinschaft“ geben, betonen Sie in Ihrem Aufsatz für das Buch Europa Aeterna. Wie soll das unter den gegenwärtigen Bedingungen gelingen können? Oder etwas konkreter gefragt: Politische Gemeinschaften sind bisher – historisch betrachtet – ausschließlich im Krieg gegen einen gemeinsamen äußeren Feind zusammengewachsen. Kommt uns also der Krieg in der Ukraine gerade sehr gelegen?
Dieser bellizistisch anmutende Erklärungsansatz, jedenfalls mit diesem Ausschließlichkeitspostulat, liegt mir ganz fern. Die Verteidigung oder der Krieg gegen einen einmütig als „Feind“ Markierten schärft ein bereits vorhandenes Bewusstsein für eine Schicksalsgemeinschaft und der gemeinsame Kampf fordert – im positiven Sinne – den Glauben und das Vertrauen in die Gemeinschaftlichkeit heraus, wenn Solidarität, Opferbereitschaft, Altruismus und Heldenmut buchstäblich eine Frage von Leben und Tod werden.
Natürlich mag man zu dem Schluss kommen, der jahrhundertelange Kampf beispielsweise gegen den expansiven Islam, sei er als Reconquista der iberischen Halbinsel, durch die Kreuzzüge, in der Seeschlacht von Lepanto oder vor der Toren Wiens geführt worden, habe die europäischen Völker erst „zusammengeschweißt“. Dennoch muss es vor dem eigentlichen Waffengang immer etwas Existentes geben, das die zu bestehenden Kämpfe erst zu gemeinsamen und den Feind zu einem gemeinsamen werden lässt. Das Gefühl von Zusammengehörigkeit oder jedenfalls von Gemeinsamkeit und eine Mindestsolidarität müssen erlebt worden sein, bevor man mit vereinten Kräften in den Kampf geht.
Unser hesperialistisches Selbstverständnis müssen wir schon selbst finden. Dabei hilft uns keine äußere Bedrohung – von welcher Macht auch immer. Nach meinem persönlichen Europaverständnis gedieh und gedeiht unser maßgeblicher Kulturraum auf dem Humus der lateinischen Christenheit, sodass ich sowohl hinter die ostkirchlich geprägte Ukraine als auch hinter das orthodox-cäsaropapistische Russland eher ein Fragezeichen setzen möchte. Ich halte es da mit Oswald Spengler, der die „russische Seele“ von der (späten) „seelischen Einheit“ des Westens, also der abendländischen Zivilisation unterschied. Übrigens soll auch der Außenminister Sergei Lawrow angeblich ein eifriger Leser von Spenglers Werken sein.
Herr Dr. Bender, vielen Dank für das Gespräch!
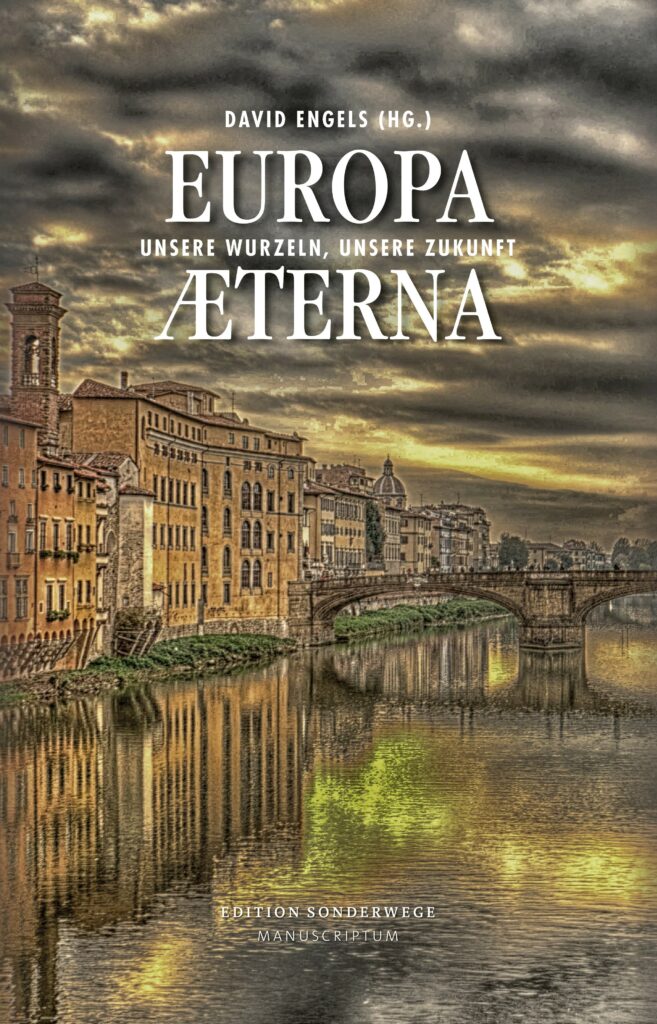
David Engels: Europa Aeterna
Was ist Europa? Hat unsere Zivilisation noch eine Zukunft? Und wer will sich überhaupt noch für ihr Überleben einsetzen?
Als Valéry Giscard d‘Estaing 2003 sein Projekt einer europäischen Verfassung vorlegte, forderten seine Kritiker, daß sämtliche Verweise auf die konstitutiven Identitätsschichten der Europäer gestrichen werden. Es blieb eine Liste beliebig interpretierbarer „universaler Rechte“, die auch von zahlreichen außereuropäischen Nationen geteilt werden können.
Der vorliegende Band mit Beiträgen namhafter europäischer Intellektueller gründet auf dem Gedanken des Hesperialismus, das heißt der Notwendigkeit eines geschichtsbewußten abendländischen Patriotismus.
