im Gespräch mit Prof. Dr. Stefan Kofner vom 19. Juli 2021.

Der gegenwärtige Sozialstaat ist nicht sozial, sondern hat viele Gemeinschaften schwer beschädigt, die früher den sozialen Zusammenhalt garantierten. Aus diesem Grund plädiert Prof. Dr. Stefan Kofner für einen „subsidiären Rückbau des Sozialstaates“ und sieht eine „raumbezogene Identitätspolitik“ zur Eindämmung der Globalisierung als ein notwendiges „Jahrhundertprojekt“ an. Im Gespräch mit Manuscriptum skizziert er, wie diese Tiefenreform gelingen kann, auch wenn sich einige Regionen bereits in einem demographischen Teufelskreis befinden.
Manuscriptum: Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Kofner, Sie unterrichten an der Hochschule Zittau/Görlitz. Nun wird über diese Region, die Lausitz, derzeit viel gesprochen. Stichwort: Kohleausstieg und „Strukturwandel“. Wie kann dieser Strukturwandel gelingen und wo sehen Sie Schwächen bei der Unterstützung „abgehängter“ Regionen?
Prof. Dr. Stefan Kofner: Zunächst einmal: Strukturwandel ist kein Selbstläufer, selbst wenn noch so viele staatliche Mittel bereitstehen. Bei weitem nicht jedes geförderte Projekt zieht eine selbsttragende, nachhaltige Entwicklung nach sich. Und je mehr Mittel in einer Region in einem bestimmten Zeitraum verteilt werden müssen, desto mehr Ineffizienz und Verschwendung handelt man sich ein.
Wie ist die Lage bei uns? Wenn man sich die üblichen Indikatoren für die sprichwörtlichen „gleichwertigen Lebensverhältnisse“ ansieht, liegt mein Heimat-Landkreis Görlitz überall ganz weit hinten: Die Bevölkerung soll nach der Prognose der Landesstatistik zwischen 2018 und 2035 um weitere elf Prozent schrumpfen. Es gibt immer weniger junge Menschen und hinzu kommt, daß der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluß über zehn Prozent liegt und nicht mal ein Viertel eines Altersjahrgangs das Abiturmacht.
Bei der anhaltenden Abwanderung und Schrumpfung ist es völlig unklar, woher die zukünftigen Fach- und Führungskräfte für Wirtschaft und Verwaltung in der Region kommen sollen. Löhne und Kaufkraft sind sehr niedrig, die Unterbeschäftigung ist zweistellig und 15 Prozent der Kinder unter drei Jahren leben in Hartz IV-Haushalten. Auf mittlere Sicht wird auch die Erwerbstätigenzahl zurückgehen und dann wird das reale BIP im Landkreis zu schrumpfen beginnen. Und dieser geprügelten Region entzieht man jetzt ihren wichtigsten industriellen Kern.
Für eine Rettung könnte es bereits zu spät sein. Die ganze Region befindet sich mitten in einem demographischen Teufelskreis. Gegenmaßnahmen müßten direkt an der Demographie ansetzen. Abwanderungstoppen, Fertilität steigern auf über drei Kinder je Frau und kulturell kompatible Zuwanderung, aber das ist viel leichter gesagt als getan. Es bringt auch nicht so viel, ein Forschungsinstitut nach dem anderen hieranzusiedeln, wenn der Fachkräftemangel der Flaschenhals ist. Die Lage ist so ernst, daß man über ungewöhnliche Maßnahmen nachdenken muß.
Es bräuchte eine Bevölkerungspolitik, die gezielt in den demographisch benachteiligten Regionen wirkt. Man müßte die Kinder gleichsam „vergolden“ und ihnen die bestmögliche Ausbildung mit auf den Weg geben. Und ihnen Lebenschancen eröffnen in Form interessanter und gut bezahlter Arbeitsplätze. Man muß die komplette Klaviatur der Bevölkerungspolitik aktivieren. Besonders wichtig sind auch regionale und personale Haltefaktoren wie zum Beispiel langfristige Ansässigkeit(auch der Vorfahren), Grundbesitz, sprachliche und kulturelle Identität(das Heimatgefühl) und soziale Netzwerke.
Denn die kulturelle Globalisierung wirkt mit der wirtschaftlichen Globalisierung zusammen und sie werden ganze Landstriche entvölkern, wenn wir die Bremse nicht finden.
Der weltbekannte Ökonom Paul Collier hat in seinem Manifest für einen sozialen Kapitalismus eine Besteuerung der Agglomerationsgewinne vorgeschlagen. Mit diesen Mitteln sollte dann die Infrastruktur in ländlichen Räumen gestärkt werden. Was halten Sie von dieser Idee der regionalen Umverteilung?
Der von mir sehr geschätzte Collier will das tatsächlich mit der Einkommensteuer machen. Das würde also bedeuten, in Düsseldorf zahlt man unter ansonsten gleichen Bedingungen deutlich mehr Einkommensteuer als in einem Dorf im Siegerland. Das gesamte Bundesgebiet müßte dafür in Wohlfahrtsstufen eingeteilt werden – so ähnlich wie bei den Mietenstufen beim Wohngeld. Außerdem sollen die Mehreinnahmen aus den reichen Städten in der Provinz wieder ausgeteilt werden und zwar in Form von Risikokapital für Pioniere, Infrastruktur-und in Hochschulförderung.
Im Prinzip ist dieser Ansatz richtig, denn die Vorteile des Freihandels und der Globalisierung verteilen sich keineswegs gleichmäßig im Raum und die Regionen, die von der Globalisierung per Saldo Nachteile haben, können zu Recht Anspruch auf einen Ausgleich anmelden. Es würden also Anreize gesetzt, gar nicht erst in die reichen Metropolen zu ziehen bzw. diese zu verlassen und in den demographisch benachteiligten Regionen zu verbleiben bzw. dorthin zu ziehen.
Man muß sich aber darüber klar sein, daß man hier versucht, endogenen zirkulären Prozessen sowohl in den Metropolen als auch in der Provinzentgegenzuwirken. Man verzichtet auf einen Teil der Vorteile räumlicher Nähe und Dichte etwa für die Rekrutierung von Fachkräften oder die Übertragung von Wissen. Insoweit gibt es einen Widerspruch zu der vorherrschenden gesamtwirtschaftlichen Wachstumsdoktrin.
Ein Hoffnungswert ist in diesem Zusammenhang die Digitalisierung: Die mit der räumlichen Nähe zu anderen Unternehmen verbundenen firmenexternen Skalenerträge verlieren aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung aller Lebensbereiche allmählich an Bedeutung. Die Kostender Dezentralität sinken und das eröffnet Spielräume für die Schrumpfung von Städten.
In Colliers Ansatz bekäme der Staat allerdings ein weiteres Umverteilungsinstrument in die Hand, wobei man seine Fähigkeiten zur effizienten Kapitallenkung nicht überschätzen sollte. Ich neige daher dazu, in der Hauptsache mit steuerlichen Anreizen zu operieren, also Steuern nach demographischen und wirtschaftlichen Kriterien zu differenzieren. Das betrifft nicht nur die Einkommensteuer, sondern etwa auch die Grund- und die Grunderwerbsteuer.
Hinzutreten muß eine raumbezogene Identitätspolitik, die besonders die kulturelle Dimension der Globalisierung eindämmt, um regionale soziale Systeme zu stabilisieren. Konkret heißt das regionale Arbeitsteilung, traditionelle regionstypische Gewerbe und Berufe, Bewahrung von Landschaft und Natur, in der Politik Subsidiarität, Dezentralisierung und Partizipation, Dialekt sowie regionale Mode, Küche, Musik, etc.
Das Heimatgefühl der Menschen ist die letzte Haltelinie.
In Ihrem eigenen, neuen Buch Gemeinsinn und Pflicht schreiben Sie, der Staat dürfe nicht als „oberster Gestalter“ in Erscheinung treten, sondern müsse „Aufgaben an die solidarischen Gemeinschaften“ abgeben. Wie soll das praktisch funktionieren, wenn es immer weniger soziale Verbundenheit gibt und viele Vereine unter Mitgliederschwund leiden?
Ich glaube, daß der Gemeinsinn als Wert, als Lebenshaltung darunter gelitten hat, daß der moderne unitarische Sozialstaat im Laufe der Zeit immer mehr Aufgaben an sich gezogen hat, die früher solidarisch und subsidiär in der Familie, in freiwilligen Gemeinschaften, Nachbarschaften, Gewerkschaften, Krankenorden oder ehrenamtlich gelöst worden sind. Natürlich kann man sich fragen, was kam zuerst, das Ei oder die Henne. Hat der Staat womöglich nur auf die Erosion von Gemeinsinn und Pflicht reagiert?
Ich meine, daß der Staat die Menschen aktiv entmündigt, ihnen Eigenverantwortung und Nächstenliebe regelrecht ausgetrieben hat. Er hat auf den gesellschaftlichen Wandel nicht nur passiv reagiert, sondern den fatalen individualistischen Wertewandel aktiv gefördert. Ich denke da insbesondere an die Rolle von Kindern und Familien in unserer Gemeinschaft.
Wie kann die Transformation, der subsidiäre Rückbau des Sozialstaates funktionieren? Einfach wird das nicht. Zunächst einmal muß die Politik wie bei den Hartz-Reformen Führung zeigen und den Rückbau ankündigen und erklären. Die Bürger müssen begreifen, daß sie wieder mehr Verantwortung für sich selbst und ihre Nächsten übernehmen müssen. Und sie müssen verstehen, daß der Bund – und schon gar nicht die EU – nicht mehr die zentrale Adresse für alle sozialen Probleme ist.
Die Zuständigkeiten werden dezentralisiert und regionalisiert und zum Teil werden gemeinnützige und private Träger soziale Aufgaben unter staatlicher Aufsicht übernehmen. Es geht nicht nur darum, was der Einzelne für sein Land tun kann, sondern auch darum, wie der Einzelne sich selbst und den Menschen, denen er sich gemeinschaftlich verbunden fühlt, helfen kann. Insoweit braucht es eine politische Rahmenerzählung als Klammer. Eine Wende, eine Abkehr von dem selbstbezogenen Individualismus. Einen fundamentalen Wertewandel hin zum Homo socialis.
Natürlich ist das eine Tiefenreform, ein Jahrhundertprojekt. Das liegt aber daran, daß wir schon jahrzehntelang mit Volldampf in die falsche Richtung gefahren sind. Der unitarische Sozialstaat ist ein Moloch, der doch jetzt – für jeden erkennbar, etwa in der Rentenversicherung – endgültig an seine finanziellen Grenzen stößt.
Bereits 1924 hat Hellmuth Plessner eine „Kritik des sozialen Radikalismus“ vorgenommen und die „Grenzen der Gemeinschaft“ aufgezeigt. Die Quintessenz dabei: Gemeinschaften könnten nur im sehr kleinen Rahmen lebendig sein. Darüber hinaus brauche es aber die Sphäre der Gesellschaft, die gerade davon lebe, dass sich die Menschen rational und emotionslos begegnen, um ihre Geschäfte zu regeln. Inwiefern berücksichtigen Sie diesen Einwand bei Ihrem Bemühen um eine kommunitaristische Ökonomie?
Plessner hat sich mit dem von Ferdinand Tönnies eingeführten Gegensatz zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft auseinandergesetzt. Nach Tönnies sind Gemeinschaften organisch gewachsen und Gesellschaften künstlich geschaffen. Die Gemeinschaft ist instinktiv, emotional und tradiert, die Gesellschaft dagegen zweckrational und künstlich. In der Gemeinschaft geht das Ganze den Teilen voraus (Familie, Dorfgemeinschaft, Freundschaft) und die Menschen verhalten sich altruistisch, während in der Gesellschaft jeder gegen jeden kämpft – innerhalb des staatlichen Ordnungsrahmens.
Aus anthropologischer Sicht sind große Gemeinschaften in diesem Sinne in der Tat schwer vorstellbar. In der Periode der Jäger und Sammler bestand eine umherziehende Gruppe aus gut 100 Menschen, die sich alle ganz gut kannten. Ein moderner Staat kann aber nicht nur auf Solidarität in solchen Kleinstgemeinschaften gebaut werden. Es braucht auch einen Zusammenhalt außerhalb der Kleingruppen wie Familie, Dorfgemeinschaft, Kleingartenverein oder freiwillige Feuerwehr.
Plessners Behauptung, die Gemeinschaft „vergewaltige“ das Grundbedürfnis des Menschen nach Selbstentwurf und Selbstverwirklichung, indem sie ihn auf ein Bild, eine einzige Idee einschwöre, trifft nur auf totalitäre übergreifende Gemeinschaften zu. Aber nicht jede identitätsmäßige Großgemeinschaft ist totalitär – das ist ein großer Irrtum.
Territorien können als Bestandteil der Ich- und der Gruppenidentität wahrgenommen werden. Ein räumliches „Zusammengehörigkeitsgefühl“ kann entstehen und dann stellt sich ganz spontan eine geteilte Loyalität gegenüber dem Ort und seinen Bewohnern ein, ohne daß man die anderen Ansässigen alle persönlich kennen würde. Menschen identifizieren sich mit ihrer Nachbarschaft, ihrem Kiez, ihrer Stadt, ihrer Region, mit ihrem Heimatland. Die Nation, das Vaterland ist in diesem Sinne eine „Gemeinschaft der Gemeinschaften“, die Klammer um alles.
Menschen, die identitätsmäßige Bindungen empfinden, sind unter Umständen bereit, sich selbstlos für die Identitätsgemeinschaften einzusetzen, denen sie angehören. Gemeinsame Ziele und geteilte Grundwerte sind natürlich hilfreich, wenn nicht erforderlich, aber einer Nation muß nicht eine starre politische Philosophie zugrunde liegen. Der Mensch ist mehr soziales Wesen als Individuum.
Herr Prof. Dr. Kofner, vielen Dank für das Gespräch!
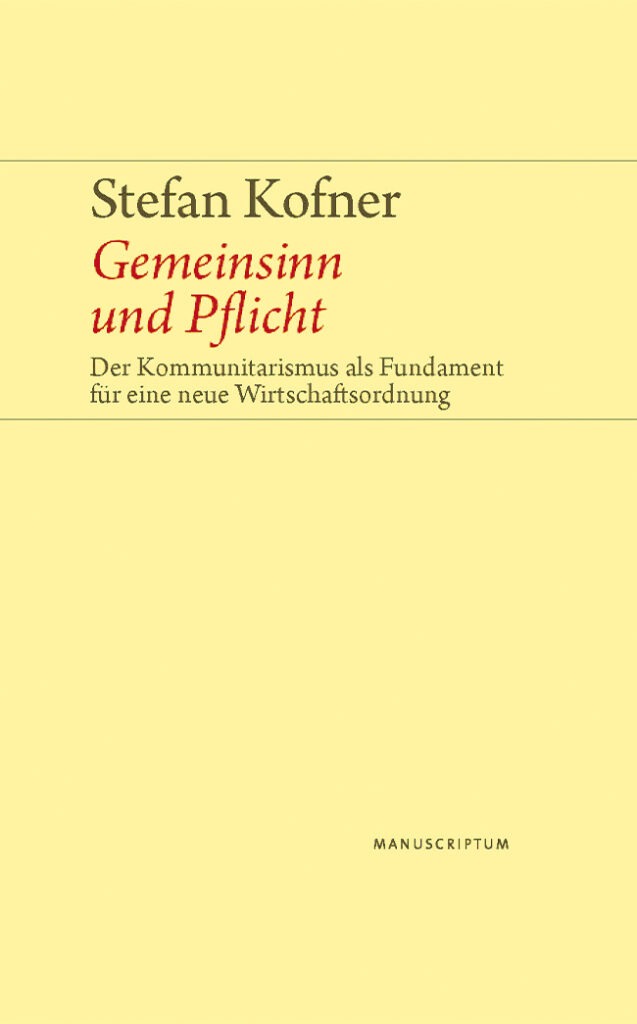
Stefan Kofner: Gemeinsinn und Pflicht.
Dieses Buch diskutiert die Rolle kommunitaristischer Ideen bei der Behandlung der Grundfragen der Wirtschafts- und Ordnungspolitik. Auf der Grundlage der kommunitaristischen Philosophie wird erstmals versucht, die theoretischen Grundlagen einer Kommunitaristischen Ökonomik zu umreißen. Da sich das Wertesystem des Kommunitarismus in wesentlichen Fragen von denen des Liberalismus und des Sozialismus unterscheidet, ergibt sich auch ein ganz anderes Verständnis der Rollen von Individuen, Unternehmen und Gemeinschaften in einer kommunitarischen Wirtschaftsordnung. Auch die Rolle des Staates ist eine gänzlich andere. Eine kommunitarische Wirtschaftsordnung zielt auf eine ethische und solidarische Vervollkommnung des Kapitalismus ab, ohne dabei einen starren Endzustand anzustreben oder einen starren Weg dahin vorzugeben. Der Kommunitarismus ist nach dem hier vertretenen Verständnis eine Graswurzelbewegung, wobei dem Staat eine aktivierende Rolle zugemessen wird.
